
Professor Dr. Holger Storf ist Professor für Medizininformatik und leitet das Institut für Medizininformatik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität und dem Universitätsklinikum Frankfurt. Das Institut ist in einer Vielzahl an nationalen und internationalen Forschungsprojekten und Aktivitäten im Bereich der Seltenen Erkrankungen involviert, z.B. ‚SE-ATLAS‘, ‚SATURN‘, ‚SeLEe‘ und verschiedenen Patientenregistern basierend auf dem Open-Source-Registersystem für Seltene Erkrankungen ‚OSSE‘.
Herr Professor Storf, wie viele Menschen in Deutschland haben eigentlich eine Seltene Erkrankung?
Prof. Storf: Eine Erkrankung gilt als selten, wenn sie eine Person von 2.000 trifft, und als ultraselten, wenn es eine Person unter 50.000 ist. Aber wie oft das jeweils vorkommt, ist insbesondere bei den ultraseltenen nicht bekannt. Wir können es bislang nur schätzen. Forschung und Versorgung sind gewissermaßen im Blindflug unterwegs.
Wieso geschieht die Versorgung von Patient:innen mit Seltenen Erkrankungen im Blindflug?
Man kennt heute etwa 8.000 Seltene Erkrankungen. Wir können von keinem niedergelassenen Arzt und keiner niedergelassenen Ärztin erwarten, dass sie alle auf dem Schirm haben. Wahrscheinlich sehen sie in ihrem gesamten Berufsleben nur ein-, zweimal eine solche Erkrankung und dann auch nur jeweils bei einer Person. Das heißt aber, dass Betroffene oft jahrelang nicht richtig diagnostiziert und behandelt werden.
Und das könnte Nationale Register für Seltene Erkrankungen (NARSE) nun ändern? Wie funktioniert es?
Die behandelnden Ärzt:innen tragen dort bei Zustimmung der Patient:innen Angaben zum Krankheitsverlauf, zur Diagnose und bisherigen Behandlung ein. Sie fragen auch ab, ob weitere Familienmitglieder betroffen sind, denn Seltene Erkrankungen sind meist erblich bedingt. Indem wir solche Daten über Jahre hinweg sammeln und auswerten, können wir die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede und den Verlauf unterschiedlicher Erkrankungen besser verstehen. Das wird Forschungsanreize setzen. Gleichzeitig wird das NARSE die Vernetzung von Betroffenen untereinander und mit behandelnden Ärztinnen und Ärzten vereinfachen.
Sind Patient:innen denn bereit, ihre Daten zu teilen?
Betroffene sind meist sehr bereit, ihre Daten für die Forschung preis zu geben. Denn oft gibt es keine Behandlungsmöglichkeiten oder nur auf einzelne Symptome bezogene. Auch hoffen sie, dass weiter an diesen Erkrankungen geforscht wird. NARSE gibt die Daten pseudonymisiert an Forschende, kann sie aber auf die Betroffenen zurückführen. So kann man sie schnell und effizient kontaktieren, wenn es eine klinische Studie gibt.
Inwiefern wird das Nationale Register für Seltene Erkrankungen die Forschung noch unterstützen?
Forschende kommen niederschwellig und datenschutzkonform an relevante Patientendaten auf Basis eines an europäischen Standards angelehnten Minimaldatensatzes. Diese europäische Anschlussfähigkeit ist wichtig, denn es braucht eine gewisse Anzahl an Patient:innen, um eine vernünftige Datenbasis zu haben und genug Biomaterial, mit dem man forschen kann. Bei Seltenen Erkrankungen ist es also umso wichtiger, Daten auch länderübergreifend zusammenzuführen.
Wie ist der Stand der Forschung zu Seltenen Erkrankungen, europäisch gesehen?
In Europa ist sie noch zersplittert, aber es gibt inzwischen verschiedene europäische Projekte, mit denen gegengesteuert werden soll: So haben sich im European Joint Programme of Rare Disease (EJP-RD) 130 Einrichtungen aus 35 Ländern zusammengeschlossen, damit es einfacher wird, dass Forschende sich untereinander finden und zusammenarbeiten können, oder dass sie an krankheitsspezifische Biomaterialien kommen, um zu forschen. Inzwischen sind 24 europäische Referenznetzwerke für Seltene Erkrankungen entstanden.
Was wäre ein echter Fortschritt für Patient:innen mit einer Seltenen Erkrankung?
Medizinischer Fortschritt ist zunehmend eine Frage hochwertiger Daten – für Menschen mit Seltenen Erkrankungen gilt das umso mehr. Schon heute entstehen in der Versorgung von Betroffenen viele solche Daten, allerdings haben wir sie noch bis letztes Jahr vor allem für Abrechnungszwecke erfasst – und für die Forschung nicht nutzbar gemacht. Ein erster guter Schritt ist, dass Seltene Erkrankungen, die stationär behandelt werden, in Deutschland seit April 2023 kodiert und damit spezifisch erfasst werden. Allerdings sollten wir nun auch die Seltenen Erkrankungen der ambulanten Patient:innen kodieren, denn Betroffene werden mehrheitlich ambulant behandelt. Sonst gehen uns viele wertvolle Informationen, die für die Entwicklung neuer Versorgungsformen und Therapien notwendig wären, verloren. Gerade bei Seltenen Erkrankungen, wo es keine Datenmassen gibt, müssen wir für hochwertige, mehrfach nutzbare Datensammlungen sorgen. Das wäre der echte Fortschritt.

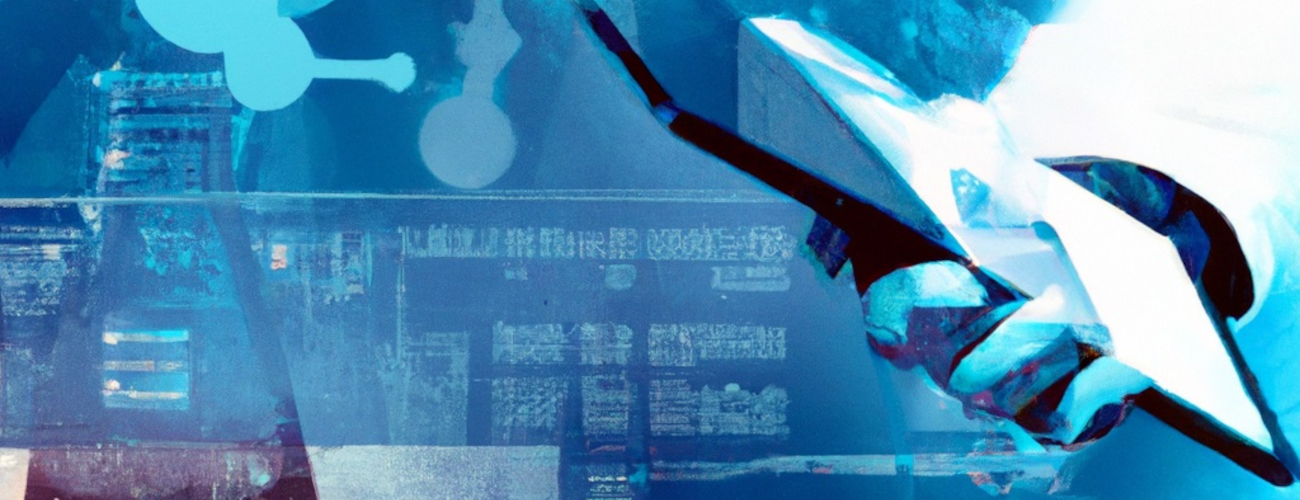
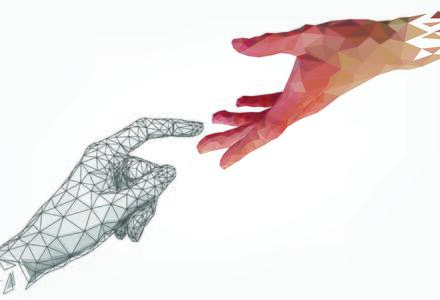




Kommentare