Was ist ein „Stigma“?
Das Wort kommt aus dem Griechischen und meint „Zeichen“ oder „Makel“ im Sinne eines Schandmals. Der US-amerikanische Soziologe Erving Goffman hat den Begriff Stigma in den 1960er Jahren in die Soziologie eingeführt: Ein Stigma ist eine negative Zuschreibung an eine andere Person aufgrund eines körperlichen, psychischen, sozialen oder verhaltensbezogenen Merkmals.
Der Begriff „Stigma“ ist kritisiert worden, da er nahelegt, der Makel läge an der stigmatisierten Person. Dabei geht die Ungerechtigkeit von den Menschen aus, die ein Merkmal stigmatisieren.
Stigmatisierung Definition: Was bedeutet „stigmatisieren“ eigentlich?
Wenn Menschen andere aufgrund eines sichtbaren oder unsichtbaren Merkmals einer Gruppe zuordnen, der sie negative Eigenschaften zuschreiben, spricht man von Stigmatisierung. Ohne die andere Person individuell zu kennen, wird sie bereits negativ bewertet: Der Mensch mit dem Hautausschlag „hat etwas falsch gemacht“ oder „ist ansteckend und gefährlich“.
Wie kommt es zu Stigmatisierung?
Dass Menschen Dinge und die soziale Welt permanent kategorisieren, ist normal. Wir reduzieren damit Komplexität. Dazu zählt auch, dass uns allen durch unsere Sozialisation ein bestimmtes Bild von „Normalität“ vermittelt wird. Der Preis dieser Effizienz ist die Präzision in der Wahrnehmung des Einzelnen. Zu Stigmatisierung kommt es, wenn jemand, der von dieser Normvorstellung abweicht, negativ beurteilt wird.
Was ist der Unterschied zwischen Diskriminierung und Stigmatisierung?
Ein negatives Vorurteil zu hegen, heißt nicht automatisch, andere schlechter zu behandeln. Man kann innerlich ein bestimmtes Stigma vergeben („Der ist neurotisch“), aber trotzdem neutral bzw. ausgewogen im Umgang sein.
Wenn ein gedankliches Vorurteil zu benachteiligendem Verhalten oder institutionellen Entscheidungen führt, ist es Diskriminierung. Wenn beispielsweise ein Wohnungsbewerber abgelehnt wird, weil er eine sichtbare Hautkrankheit hat. Oder wenn ein junger Erwachsener mit Krebs trotz fachlicher Eignung nicht befördert wird.
Diskriminierung heißt also, dass eine Person bewusst oder unbewusst ihr Verhalten nach inneren Vorurteilen ausrichtet und eine andere dadurch benachteiligt.
Was bedeutet institutionelle und strukturelle Diskriminierung?
Diskriminierung kann von Individuen ausgehen, von der Öffentlichkeit oder institutionell bedingt sein durch die Normen und Werte bestimmter Institutionen bzw. gesellschaftlicher Teilbereiche, wie das Rechtssystem, die Arbeitswelt oder das Gesundheitssystem. Die Ebenen greifen meist ineinander.
Institutionelle Diskriminierung heißt, dass die Regeln und Abläufe in Institutionen der jeweiligen Bereiche (Gesundheit, Arbeit, Recht, …) bestimmte Personen benachteiligen oder gefährden. Das kann absichtlich oder unabsichtlich geschehen, auch ohne, dass sich Einzelne diskriminierend verhalten. Schlägt sich institutionelle Diskriminierung in der Ungleichbehandlung oder gesundheitlicher Unterversorgung ganzer gesellschaftlicher Teilgruppen aus, spricht man auch von struktureller Diskriminierung: So ist beispielsweise die Unterfinanzierung der Versorgung bestimmter Erkrankungen im Vergleich zu anderen eine strukturelle Diskriminierung. Oder, wenn Medizin sich am Modell „Mann“ orientiert, statt Gendermedizin zu beachten. Oder, wenn Menschen nicht gleichermaßen Zugang zu Prävention haben.
Auch die Diskriminierung durch ein Rechtssystem kann negative Gesundheitsfolgen haben, wie folgendes Beispiel zeigt: Nachdem in den USA gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt worden sind, sank die Zahl der Depressionen oder das Vorkommen von Bluthochdruck bei schwulen und bisexuellen Männern.
Wie sehr ist unsere Gesellschaft durch Stigmatisierung beeinflusst?
Seit Jahrhunderten prägen bestimmte Ungleichheitsvorstellungen unsere Gesellschaft, die sich auf bestimmte Merkmale beziehen: Sexismus führt zur Ungleichbehandlung aufgrund des zugeschriebenen Geschlechts, Heterosexismus zur Ungleichbehandlung aufgrund einer Normvorstellung über die sexuelle Orientierung und die binäre Geschlechtervorstellung von Männern und Frauen, Rassismus aufgrund der Hautfarbe bzw. zugeschriebener Kultur oder Herkunft, Antisemitismus aufgrund der Zuschreibung zum Judentum. Von Ableismus spricht man, wenn Menschen mit einer Behinderung oder (chronischen) Erkrankung benachteiligt werden – aufgrund der Normvorstellung, dass alle Menschen körperlich gleich funktionieren müssen. Klassismus beurteilt Menschen nach ihrem sozialen Status und der damit zugeschriebenen Funktionalität für die Gesellschaft aufgrund einer bestimmten Norm.
Welche Folgen hat Stigmatisierung im Gesundheitsbereich?
Stigmata mit all ihren Folgen können zu ausbleibenden Untersuchungen, Unterbehandlung und falschen Diagnosen führen. Durch die Stigmatisierung von psychischer Krankheit, beispielsweise, wird eine entsprechende Symptomatik beispielsweise übersehen oder unterschätzt werden, falsch oder gar nicht diagnostiziert – so dass sich die psychische Erkrankung verschärft oder weitere gesundheitliche Symptome hinzukommen. Die Diskriminierungsforscherin Dr. Janine Dieckmann sieht darin ein Public-Health-Problem.
Bei Erkrankungen wie Adipositas, kreisrundem Haarausfall oder Hautkrankheiten wiegt die damit einhergehende Stigmatisierung manchmal schwerer als die Symptome selbst. Diskriminierung ist ein chronischer Stressor, der sich negativ auf die Gesundheit auswirkt und nachweislich psychosomatische Reaktionen auslösen kann. Besonders gefährlich ist die Selbst-Stigmatisierung: Wenn Menschen die Vorurteile Anderer gegen sich selbst richten. Da sich jemand für seine Alkoholabhängigkeit schämt, sucht er:sie nicht oder spät professionelle Hilfe. Dies wiederum verschärft die Erkrankung oder kann zu einer Chronifizierung führen.
Was bedeutet Selbststigmatisierung?
Selbststigma entsteht, wenn Menschen Vorurteile über ihre eigene „Gruppe“ gegen sich selbst wenden. Es ist sozusagen die Internalisierung gesellschaftlicher und gelernter Vorurteile, man fühlt sich beispielsweise Schuld an der eigenen Depression. Selbststigmatisierung senkt das Selbstwertgefühl, sie kann zu Scham, sozialer Isolation und Demoralisierung führen – eine Negativschleife, aus der man nur schwer herauskommt. Auch kann Selbststigmatisierung dazu führen, dass man zu spät ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt. Bei psychischen Erkrankungen ist es auch ein Risikofaktor für Suizidalität, wie Studien mittlerweile zeigen.
Was ist Stigma durch Assoziation?
Angehörige von Menschen mit bestimmten Erkrankungen und Menschen, die mit ihnen arbeiten, können von negativen Beurteilungen mitbetroffen sein. Das Stigma greift dann auf das Umfeld über. Etwa auf Mitarbeitende von AIDS-Beratungsstellen. Oder auf Mütter psychisch erkrankter Kinder, denen unterstellt wird etwas falsch gemacht zu haben.
Die Stigmatisierung psychisch Kranker
Für viele Menschen mit psychischer Erkrankung wiegt das Stigma mit all seinen Folgen schwerer als die Symptome der eigentlichen Erkrankung. Deshalb wird das Stigma auch als „zweite Krankheit“ bezeichnet. Werden Menschen mit einer psychischen Erkrankung abgewertet und diskriminiert, führt das oft dazu, dass sie aus Scham erst spät zum Arzt gehen und später als notwendig eine passende Behandlung bekommen. Die Heilungschancen sinken so. Die Stigmatisierung zerstört auch zwischenmenschliche Beziehungen, der Arbeitsplatz kann verloren gehen. Betroffene landen so oft in der sozialen Isolation. Schlimmstenfalls können auch Armut, Obdachlosigkeit und Suizide eine Folge sein.
Stigmatisierung von Depressionen
Menschen, die gerade eine depressive Episode durchleben, treffen nach wie vor auf wenig Verständnis in ihrem Umfeld. „Jeder hat mal einen schlechten Tag“ und „Reiß dich mal zusammen“ sind typische Kommentare, die zeigen, welche Vorurteile über Depression herrschen. Obwohl die Erkrankung inzwischen häufig Thema in Büchern, Filmen und sozialen Medien ist, werden Betroffene in unserer Gesellschaft noch immer stark stigmatisiert. Ein Grund dafür ist Nichtwissen: Wir verstehen die Ursachen und Gründe von Depressionen noch nicht vollständig. Es fällt uns zudem schwer, das Denken und Empfinden der Betroffenen nachzuvollziehen. Das Bedürfnis, sich von Menschen mit Depression abzugrenzen, ist daher groß. Deshalb behaupten wir eher, es mangele den Betroffenen nur an Selbstdisziplin oder sie seien faul. Diese kämpfen dann mit einer doppelten Belastung: den Symptomen und Folgen einer Depression sowie der Stigmatisierung, die mit ihr verbunden ist.
Gewichtsdiskriminierung: Die Stigmatisierung von Adipositas
Menschen mit Adipositas leiden wie alle, die stigmatisiert werden, doppelt: Zum einen unter den Folgen des starken Übergewichts, das die Lebensqualität im Alltag sehr beeinträchtigen und weitere Erkrankungen nach sich ziehen kann. Zum anderen führt die Stigmatisierung zu erhöhtem psychischen Leid. Weil sie die ihnen begegnenden Stigmata annehmen, leidet das Selbstwertgefühl der Betroffenen. Sie können ihre Situation noch schlechter bewältigen. Weil sie sich selbst abwerten, suchen sie auch seltener Hilfe auf. Die Stigmatisierung von Menschen mit Adipositas beginnt Studien zufolge bereits im Kindesalter. Sie tritt nicht nur in persönlichen Beziehungen und in Ausbildung und Beruf auf, sondern auch im Gesundheitswesen. Das kann Prävention und Behandlung negativ beeinflussen.
Entstigmatisierung: Was tun gegen Stigmatisierung und Diskriminierung?
Auf individueller Ebene haben sich drei Maßnahmen als diskriminierungsmindernd erwiesen: Protest, Aufklärung, Begegnung. Bei so genannten Kontaktinterventionen von stigmatisierenden und stigmatisierten Gruppen sind drei Bedingungen wichtig, um Erfolg zu haben:
- Augenhöhe
- ein gemeinsames Ziel
- keine aufgedrückte Kontaktsituation
Doch es reicht nicht, Stigmatisierung und Diskriminierung nur auf individueller Ebene anzugehen. Auf institutioneller Ebene braucht es den diskriminierungskritischen Blick auf traditionelle Abläufe und Routinen sowie ein Bewusstsein dafür, dass es Normvorstellungen gibt. Es braucht eine entsprechende Kultur mit Leitbildern und Richtlinien.
Quellen:
Janine Dieckmann:
Was ist Diskriminierung?
Über illegitime Ungleichbehandlung, Demokratie und Sand im Getriebe. 2017 https://www.idz-jena.de/pubdet/wsd1-12
Nicolas Rüsch:
Das Stigma psychischer Erkrankung. Elsevier 2020
Stiftung Gesundheitswissen: Selbst schuld? – Stigmatisierung von Krankheiten.
https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/gesundes-leben/psyche-wohlbefinden/selbst-schuld-stigmatisierung-von-krankheiten (abgerufen im Februar 2023)






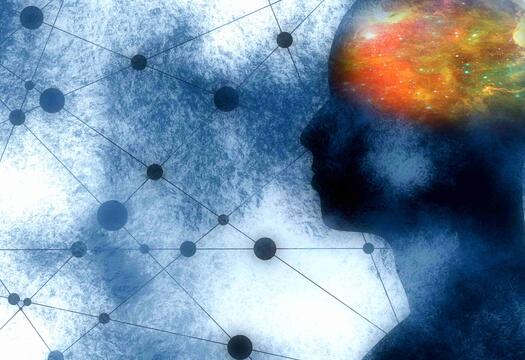

Kommentare