Ein fensterloser Gang, Metalltüren, dahinter Labors und Büros des Fachbereichs Chemie an der Freien Universität Berlin. Hier forscht Professor Dr. Peter H. Seeberger, außerdem ist er Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung. Seebergers bisher größter Coup: die Entwicklung einer automatischen Synthese-Maschine für Kohlenhydrate. Damit kann er Mehrfachzucker von Krankheitserregern künstlich herstellen und sie zu Impfstoff-Kandidaten für Malaria, Lungenentzündung, Milzbrand oder Tuberkulose verarbeiten; die britische Zeitschrift „Medicine Maker“ führte ihn 2015 im weltweiten Ranking der „Medizinmänner“ auf Rang sieben.
Warum wird einer Wissenschaftler für Grundlagenforschung? Ist das nicht furchtbar dröge, so fern von der Anwendung?
Seeberger: Gar nicht. Grundlagenforschung ist für mich ein ideales Feld, da noch so viel unentdeckt ist! Ich möchte Ergebnisse sehen und Dinge tun, die vorher noch niemand tat. Dieser Entdeckergeist treibt mich an: Das Unmögliche möglich machen. Außerdem: Als Chemiker bin ich doch Praktiker. Alles, was wir uns überlegen, wird umgesetzt – wir stellen uns ins Labor und legen los.
Der Chemiker Prof. Seeberger hat mit der automatisierten Zuckersynthese die Entwicklung neuartiger Impfstoffe, Therapien und Diagnostika ermöglicht
Ehrgeiz oder Neugier – was ist der kräftigere Motor?
Seeberger: In der Forschung braucht man Ehrgeiz, um die Neugierde durchzusetzen – um wirklich etwas zu verstehen. Nur mit seiner Hilfe kommt man in die richtigen Tiefen bei der Grundlagenforschung. Doch die Neugierde auf Innovationen bleibt eine stete Gefährtin. Denn die Forschung ist eine Matroschkapuppe: Je tiefer es geht, desto öfter entpuppt sich Neues. Denn gerade in den banalen Angelegenheiten steckt Großes: Wir wollten einmal in großem Maßstab von den beiden Elektronen im Sauerstoff, die in einer gewissen Ordnung stehen, eines umdrehen; wir wollten sehen, ob man das dann in der Chemie besser nutzen kann. Als es uns gelang, öffneten wir damit – ohne es vorher geplant zu haben – die Tür dafür, um die wichtigsten Malariamedikamente viel billiger herzustellen.
Wie das?
Seeberger: Umgedrehte Elektronen regen den Sauerstoff so an, dass er besser reagieren kann, und der vermag aus dem Abfall der Beifußpflanze ein Malariamedikament zu machen. Große Entdeckungen und Innovationen waren immer mit einer Überraschung verbunden – auch wenn mancher sagt: Das habe ich alles vorher geahnt und geplant. Der Forscher braucht ein offenes Wesen, um nicht nur das zu sehen, was er sucht.
Die Romanfigur Sherlock Holmes gab sich immer unüberrascht. Fühlen Sie sich auch so? Oder mehr wie ein Schwimmender auf offener See?
Seeberger: Ich treibe schon eher im Meer des Unentdeckten. Erst, wenn ich mit viel Bauchgefühl auf etwas Interessantes stoße, beginne ich mit der Systematik eines Holmes. Und falls ich auf eine neue Erkenntnis stoße, könnte ich auch mit seiner Arroganz auftreten, wenn ich wollte. Es wird ja nur über unsere Erfolge in der Forschung geschrieben, unsere Misserfolge bleiben unerwähnt.
Was war Ihr größter Misserfolg als Wissenschaftler?
Seeberger: Vor 16 Jahren haben wir einen Impfstoffkandidaten gegen Malaria entdeckt und beschrieben. Am Ende wurde er nicht klinisch getestet, weil es keinen Markt gibt, der das bezahlen kann. Vielleicht war es auch nicht der richtige Impfstoff – aber wer weiß...
Was sagte Ihnen denn das Bauchgefühl, als Sie sich die Zucker vornahmen?
Seeberger: Das war kühles Überlegen. Es gibt drei große Biopolymere, also Makromoleküle, die für die biologische Informationsübertragung zuständig sind. Das sind die DNA, die Proteine und eben Zucker. Nur letzteres konnte man noch nicht synthetisch zusammenbauen. Also setzte ich mich dran. Immerhin bilden Zucker 80 Prozent der weltweiten Biomasse. Viele hielten es damals für technisch zu schwierig, wir wussten einfach zu wenig über die Zucker. Aber genau diese hohe Hürde faszinierte mich. Wenn das einer schafft, dachte ich, eröffnet es ganz neue Arten der Biologie und der Medizin.
Und wenn Sie am Anfang gleich gescheitert wären?
Seeberger: Das hätte gut passieren können. Ich hatte großes Glück bei meinen Forschungen. Zufällig setzte ich bei meinen Syntheseversuchen auf die richtige Zuckerart; mit Glukose zum Beispiel hätte eine Herstellung damals nicht funktioniert. Dann hätte ich keine Professur am MIT in Cambridge erhalten, keine am ETH in Zürich und schließlich wäre ich heute nicht Direktor am Max-Planck-Institut in Potsdam. Vielleicht wäre ich in die Wirtschaft gegangen und hätte im Beratungsbereich gearbeitet, das wäre kein Beinbruch gewesen. Man muss es nehmen, wie es kommt.
Auch wer scheitert, sorgt für Erkenntnis.
Seeberger: Ja, für die Wissenschaftler danach. Ich erwarte von meinen Leuten, dass sie arbeiten, sich gute Gedanken machen und auf der Grundlage überzeugender Hypothesen experimentieren. Wenn das Experiment nicht funktioniert, ist es nicht schön, aber auch nicht schlimm. Wir können uns nur nach bestem Gewissen herantasten. Wer nur „gute Ergebnisse“ im Kopf hat, riskiert wissenschaftliches Fehlverhalten. Am Anfang darf nicht die Antwort stehen. Misserfolge gehören dazu! Eine Leidensfähigkeit wird in der Forschung vom Master-Studierenden ebenso verlangt wie vom Institutsdirektor.
Wenn Sie etwas verstanden haben – was geht in Ihnen vor?
Seeberger: Dafür Worte zu finden, fällt schwer. Ich hatte diese Woche solch ein Glücksmoment, als es einem Doktoranden gelungen ist im Labor zu zeigen, wie kleine Zuckermoleküle sich zu langen Fäden verspinnen können – wie die feinen Fasern bei der Alzheimer-Erkrankung. Das wusste man vorher nicht. Schauen Sie mal... Er holt sein Smartphone raus und öffnet einen Film: Rosafarbene Pusteln bilden Fäden, verlängern sich. Dann vereinigen sie sich, platzen auf und sehen am Ende aus wie ein Seeigel in Pink. Ist es nicht wunderschön? Chemiker stoßen deutlich seltener auf eine ästhetische Schönheit als Materialwissenschaftler, denn wir arbeiten an Molekülen, die wir an sich nie sehen – oft nur durch Spektroskopiedaten und Kurven. Astronomen sehen eine andere Schönheit, wenn sie in ferne Galaxien schauen. Uns berauschen Zahlenreihen.
Wie würden Sie die Schönheit eines Moleküls beschreiben?
Seeberger: Wenn ich ein Molekül erschaffe, stelle ich es mir vor. Ich baue vor meinem geistigen Auge verzweigte Zuckerketten: unglaublich komplex und elegant, alle miteinander vereint. Dann wird das ganze im Reagenzglas Wirklichkeit, und ich habe erschaffen, was es vorher nie gab. Es hat etwas Göttliches. Sowas bringt einen positiv um den Schlaf, ein echter Adrenalinausstoß. Vergleichbar mit dem Rekord für einen Sportler – umso mehr, wenn dieses neu Geschaffene eine bessere Immunantwort des Menschen in sich birgt, zum Beispiel auf Krankenhauskeime.

Prof. Dr. Peter H. Seeberger ist Direktor des Departments für Biomolekulare Systeme am Max-Planck Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam und Professor an der Freien Universität Berlin. Seit 2011 ist er Honorarprofessor an der Universität Potsdam. Seine Arbeitsgruppe forscht im Grenzgebiet von Chemie und Biologie. Neben bahnbrechenden Erfindungen im Bereich der automatischen Synthese komplexer Zucker entwickelt er neue kontinuierliche Synthesemethoden für die Totalsynthese von Wirkstoffen.



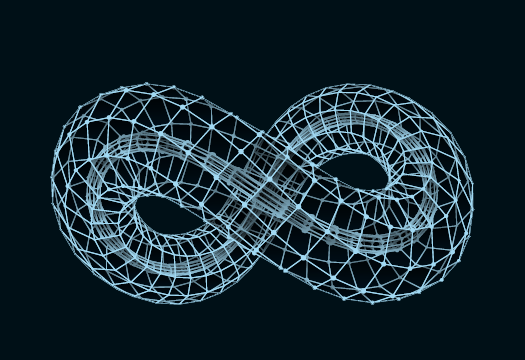

Kommentare