Sie haben sich einmal als Systemdesigner bezeichnet. Wie kamen Sie überhaupt dazu, Präventivsysteme wie Gesundes Kinzigtal zu konzipieren?
Dr. Hildebrandt: Ich war in den 1980ern in der Stadtteilarbeit aktiv und wir wollten die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gezielt fördern. Bis heute habe ich den Satz eines kleinen marokkanischen Jungens im Kopf, der sagte: Wenn ich traurig bin, dann bin ich auch krank. Er hat seine Gesundheit ganzheitlich gefühlt.
Damals wurde deutlich, dass wir Gesundheit eigentlich in einem größeren Kontext sehen müssen. Es war eine Zeit, in der man über gesunde Ernährung und gesundes Brot diskutierte und die Umweltschutzdebatte an Fahrt aufnahm. Für mich war es das Gleiche.
Inwiefern?
Erst machen wir die Umwelt kaputt und dann versuchen wir, das wieder irgendwie in Ordnung zu bringen. Stattdessen könnten wir durch kluge Lösungen erst gar nicht so viel Schmutz produzieren. Genauso in der Gesundheit: Jemand wird krank, es entsteht ein Leistungsbedarf und dieser Leistungsbedarf muss angemessen vergütet werden. Wir setzen damit also rein betriebswirtschaftlich betrachtet den Anreiz zur Leistungsvermehrung auf der falschen Seite. Als ich 1984 länger in den USA war, fand ich die Health Maintenance Organizations wie Kaiser Permanente sehr interessant. Da sie eine feste Einnahme pro Monat von den Versicherten bekamen, hatten sie den Anreiz, Patient:innen so gesund wie möglich zu halten.
Wäre das amerikanische Modell eine Option für Deutschland gewesen?
Obwohl von der damaligen amerikanischen Entwicklung eine hohe Faszination ausging, war das in Deutschland nicht umsetzbar. Erst Anfang der 1990er kam der Gedanke auf, Ärzt:innen als Partner zur Kostenvermeidung mit an Bord zu nehmen. Es dauerte allerdings noch bis zur Jahrtausendwende, bis der Paragraph § 140a ins Sozialgesetzbuch geschrieben wurde, der es Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen und Krankenkassen erlaubt, miteinander Verträge zu machen.
Was ist die Voraussetzung für ein auf Prävention ausgelegtes Modell wie Gesundes Kinzigtal – Wie hat es funktioniert?
Wir haben ein virtuelles Globalbudget für die Region übernommen: Unser Angebot war, dass wir die Gesundheitsversorgung so organisieren, dass mehr Gesundheit entsteht und dadurch weniger Kosten erzeugt werden. Dazu haben wir eine GmbH gegründet, die gegenüber den Krankenkassen in eine Kosten- und Ergebnismitverantwortung für die Versicherten in der Region geht und dahinter Ärzt:innen, Pflegedienste, Physiotherapeut:innen und weitere Gesundheitsakteure versammelt. Das Versprechen war, dass wir das positive Delta, das bei der Einnahmen- zu Kostenentwicklung für die Krankenkasse entsteht, zwischen Krankenkasse und uns teilen. Es entstand also der Anreiz, Gesundheitsnutzen zu schaffen.
Sie haben damals auch Kitas, Sportvereine, Arbeitgeber mit ins Boot geholt, um Gesundheit zu fördern.
Unser Prinzip ist es, so früh wie möglich anzufangen. Auch in der medizinischen Versorgung: Nicht erst warten, bis ein Patient mit Bluthochdruck in die Niereninsuffizienz rutscht oder Richtung Schlaganfall und Herzinfarkt. Gesundes Kinzigtal und all unsere weiteren Projekte bundesweit gehen jeweils von der regionalen Gesundheitslage aus: Wir schauen, welche Bedarfe es gibt, welche Krankheitsrisiken bestehen, und agieren entsprechend. Die Versorgung wurde also gezielt auf die Bevölkerung ausgerichtet und setzte viel früher ein.
Was kam dabei heraus?
Tatsächlich stiegen die Ausgaben für Gesundheit für die Bevölkerung im Kinzigtal weniger an als im Durchschnitt. Wir verzeichneten mehr gesunde Lebensjahre und eine niedrigere Sterblichkeit. Die OECD hat unsere Daten erst vor kurzem hochgerechnet. Bei Ausweitung unseres IV-Modells auf ganz Deutschland könnten den Modellierungen nach von 2022 bis 2050 mehr als 146.000 Lebensjahre gewonnen und knapp 100.000 Lebensjahre mit Einschränkungen durch Behinderungen oder Erkrankungen vermieden werden. Es wurden außerdem einzusparende Kosten von 4,6% errechnet – angewandt auf die aktuellen Gesundheitsausgaben der GKV von knapp 300 Mrd. Euro im Jahr 2023 entspräche die Ersparnis etwa 14 Mrd. Euro.
Warum werden solche Modelle nicht systematisch in die Fläche gebracht?
Weil nicht geklärt ist, wer verantwortlich ist. Wer ist denn in einem Berliner Kiez oder einem thüringischen Landkreis verantwortlich für die Ergebnisse der Versorgung? – Niemand. Jede der 25 Krankenkassen kümmert sich nur um ihre Versicherten, aber nicht um die Versorgung insgesamt. Auch der Landrat oder die Landrätin haben keine Macht. Die Ärzt:innen haben ihre eigene Praxis vor Augen und nicht die Versorgung des Landkreises. Genauso das Krankenhaus, die Pflegeheime, die ambulanten Pflegedienste, die Physiotherapeuten – alle kümmern sich jeweils um ihre reinkommenden Patient:innen. Aber es gibt niemanden, der das koordiniert, zentral ausrichtet und die Weichen umstellt.
Könnte man trotzdem umsteuern, Impulse setzen?
Es muss ein Interesse geben an der Gesundheit der Population. Das heutige Gesundheitswesen setzt keinen wirklichen Anreiz für Prävention. Die einzigen, die ein gewisses wirtschaftliches Interesse haben, sind die Krankenkassen. Aber auch sie haben keinen wirklichen Anreiz, denn über den Risikostrukturausgleich werden sie im Grunde bestraft werden, wenn sie in Prävention investieren.
Weil sie dann weniger Zuweisungen bekommen, wenn ihre Mitglieder gesünder sind …
Genau – ein Fehlanreiz, der schon zur Gründung des Morbi-RSA diskutiert worden ist. Das Leibniz-Zentrum für Wirtschaftsforschung Mannheim (ZEW) hat jüngst Vorschläge gemacht, wie man das glätten kann. Etwa, indem Versichertenzuweisungen über zehn Jahre gesichert sind, auch wenn sie in Prävention investieren und die Leute gesünder werden.
Welche Stellschrauben würden Sie noch drehen?
Wir sollten Krankenkassen nicht nur über ihre Leistungsmenge oder ihre Zusatzbeiträge bewerten, sondern auch an der Frage messen, ob sie es schaffen, ihre Versicherten gesünder zu machen. Da die Krankenkassen ihre Kostenabgaben pro Patient:in an das Bundesamt für soziale Sicherung in Deutschland richten müssen, könnte man das dort messen. Und die Krankenkasse hätte den Anreiz, möglichst viel zugunsten ihrer schwierigen Patient:innen zu machen.
Müsste man nicht schon viel früher anfangen, als bei den Krankenkassen? Bei den Bürger:innen?
Wir sollten zurückhaltend damit sein, einzelnen Personen etwas aufzuoktroyieren. Druck hilft gar nicht und wir müssen nicht zuletzt aufpassen, dass wir die soziale Denke unserer eigenen Schicht nicht auf andere übertragen. Jemandem, der körperlich sehr hart und unter schwierigen Bedingungen arbeitet, die gleichen Empfehlungen zu geben wie jemandem, der als gut bezahlter Freiberufler unterwegs ist, macht keinen Sinn.
Entscheidend sind die jeweiligen Lebensumstände genauso wie die Verhältnisse drumherum- Ich finde, die Weltgesundheitsorganisation hat das super ausgedrückt: Make the healthier choice the easier choice. Insofern kann man sich schon fragen, warum es solch einen Aufschrei von einer Ampelpartei gibt, wenn jetzt zumindest tagsüber die Werbung für gesundheitsschädliche Süßigkeiten für Kinder gestoppt werden soll. Und man kann sich auch fragen, warum sich nicht alle Krankenkassen um diese Fragen kümmern, sie hätten ja die Argumente. In einem System, das ein Interesse an Gesundheit hat, würden sich die Systempartner und -träger auch um solche Fragen kümmern.
Aber bei uns gibt es noch kein institutionalisiertes Interesse an Prävention. Mit den Gesundheitsregionen, die im Entwurf des GVSG vorhanden waren und ja vielleicht auch wieder hereinkommen, hätte man einen Hebel, so ein Interesse zu institutionalisieren. Hoffen wir das Beste.



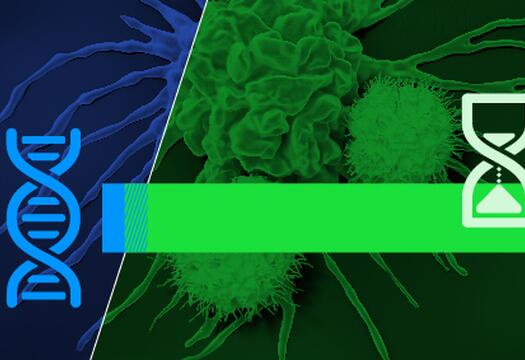

Kommentare