
Mitbegründer Professor Dr. rer. nat. Michael Krawczak, Direktor des Instituts für Medizinische Informatik und Statistik der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel, über die Chancen der datengetriebenen Gesundheitsforschung.
Herr Prof. Krawczak, was ist eine Biobank?
Eine Biobank ist eine umfangreiche Sammlung von Biomaterial und Daten von gesunden und kranken Menschen, die für biomedizinische Forschungszwecke angelegt wird. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können damit z.B. molekulare oder ernährungsbedingte Risikofaktoren für Zivilisationserkrankungen erforschen. Ihre Ergebnisse können dann zu einer verbesserten Prävention, Diagnostik und Behandlung dieser Erkrankungen beitragen.
Welche Daten sammelt die Biobank popgen?
Unsere Kieler Biobank popgen enthält Biomaterial und Daten zu einer Vielzahl krankheitsspezifischer Fragestellungen. Sie ist eine der größten Sammlungen ihrer Art in Deutschland. Die in popgen eingeschlossenen Personen stammen fast alle aus Schleswig-Holstein und wurden von Kolleginnen und Kollegen des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein Campus Kiel über Jahrzehnte hinweg zur Teilnahme eingeladen, untersucht und betreut.
Um welche Erkrankungen geht es?
Die Initiative für popgen ging 2003 von meinem Kieler Kollegen Prof. Dr. Stefan Schreiber aus, einem Internisten mit großem Interessen an chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Popgen wurde zunächst vom Nationalen Genomforschungsnetz des Bundes und später von Land Schleswig-Holstein gefördert. Schon bald ging es uns aber nicht nur um den Darm, sondern z.B. auch um Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Außerdem haben wir ab 2006 Biomaterial und Daten einer Kontrollkohorte gesunder Personen aus dem Großraum Kiel gesammelt.
Wie kamen Sie an die Daten dieser gesunden Personen?
Sie wurden über das Einwohnermeldeamt nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und dann von uns alters- und geschlechtsspezifisch angeschrieben. Etwa 20% sagten damals zu und kamen in den folgenden Jahren regelmäßig ins Studienzentrum Kiel.
Welche Gesundheitsdaten werden von den Teilnehmern an popgen erhoben?
Neben Blutproben, die im Wesentlichen zur DNA-Extraktion dienten, haben wir umfangreiche klinische und demografische Daten gesammelt. Früher konnten interessierte Forscher bei popgen die Bioproben anfordern. Inzwischen sind diese aber mit vielen Techniken so eingehend untersucht worden, dass wir statt der Proben nur noch die daraus gewonnenen Daten herausgeben.
Wer fragt diese Daten aus der Biobank an?
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt. Es gibt inzwischen mehr als 60 verschiedene Studien, die auf Daten und Bioproben aus popgen basieren.
Was wird mithilfe der Biobank konkret erforscht?
Es wird z.B. erforscht, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs oder entzündliche Erkrankungen entstehen oder wie es zu Allergien kommt. Die popgen-Studien untersuchen genetische Risikofaktoren, aber auch, ob bestimmte Ernährungsweisen mit Entzündungen im menschlichen Körper zusammenhängen. Eine Besonderheit von popgen ist die deutschlandweit einmalige Familienkohorte zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Zu den über 3000 Teilnehmern an dieser Kohorte gehören neben Patientinnen und Patienten auch deren enge Verwandte. Alle Personen werden seit nunmehr 10 Jahren regelmäßig zum weiteren Verlauf der Erkrankung bzw. zum Auftreten von Neuerkrankungen befragt.
Wie stehen die Menschen zu Forschung mit ihren Daten – und dürfen auch forschende Unternehmen mit der Biobank arbeiten?
Die Daten und Bioproben dürfen nicht kommerzialisiert werden, Beschränkungen für die Forschung durch kommerzielle Einrichtungen bestehen aber nicht. Eine forsa-Umfrage aus dem Jahr 2022 hat übrigens ergeben, dass weit über 60 Prozent der Bevölkerung die Nutzung ihrer klinischen Daten durch die kommerzielle Forschung befürworten. Vor der Pandemie waren es nur 20 Prozent. Viele Menschen haben durch COVID-19 erlebt, dass medizinische Probleme von der akademischen Forschung allein nicht zu lösen sind. Ich bin davon überzeugt, dass eine langfristig patientendienliche Forschung immer in Kooperation zwischen Hochschulen und privaten Einrichtungen laufen wird. Wichtig ist es, den Menschen verständlich und offen zu erklären, was mit ihren Daten geschieht.
Welche Erwartungen können wir an datenbezogene Gesundheitsforschung haben?
Aus meiner Sicht besteht großes Potenzial für eine engere Verzahnung von Forschung und Versorgung unter dem Stichwort „lernende Versorgung“. Anders als bei klassischen wissenschaftlichen Studien können Daten, die in der Versorgung anfallen, auch unmittelbar zur Wissensgenerierung genutzt werden. Dieser Ansatz wird umso leistungsfähiger sein, je mehr Datenbestände sich miteinander verknüpfen lassen. So stecken etwa in den klinischen Krebsregistern viele wertvolle Daten, aus denen sich Evidenz für die unmittelbare Versorgung anderer Patienten ableiten ließe. Lernende Versorgung wird das klassische wissenschaftliche Studiendesign nicht ablösen, aber als zweiter Ast der Wissensgenerierung eine immer größere Rolle spielen.
Wir haben 16 verschiedene Landes-Datenschutzgesetze – wie sehr behindert das die medizinische Forschung?
Das Problem ist gar nicht so sehr die Vielzahl der Gesetze, es ist vielmehr deren unterschiedliche Auslegung. Regelungen im Saarland sind nicht grundverschieden von denen in Bayern, aber die bestehenden Interpretationsspielräume können zu erheblicher Verunsicherung führen. Deshalb ist ein konstruktiver Dialog mit und zwischen den Datenschutzbeauftragten auf allen Ebenen so wichtig.
Warum unterscheiden sich Landes-Datenschutzgesetze überhaupt?
Das ist historisch im Zuge der föderalen Gesetzgebung so gewachsen. Aber wie gesagt: Wenn man die Landesdatenschutzgesetze nebeneinanderlegt, sieht man, dass sie sich nur wenig unterscheiden. Trotzdem wäre für übergreifende Forschungsprojekte eine bundeseinheitliche Gesetzgebung und insbesondere eine einheitliche Interpretation wünschenswert. Allerdings hat der lokale Dialog mit Datenschutzbeauftragten auch seine Vorteile. Viele Probleme lassen sich dabei „auf dem kurzen Dienstweg“ lösen. Wenn man die Datenschutzgesetzgebung also zentralisiert, müsste man dabei aus meiner Sicht genau hinschauen, was man aufgibt und was man gewinnt.
Artikelbild: Shutterstock

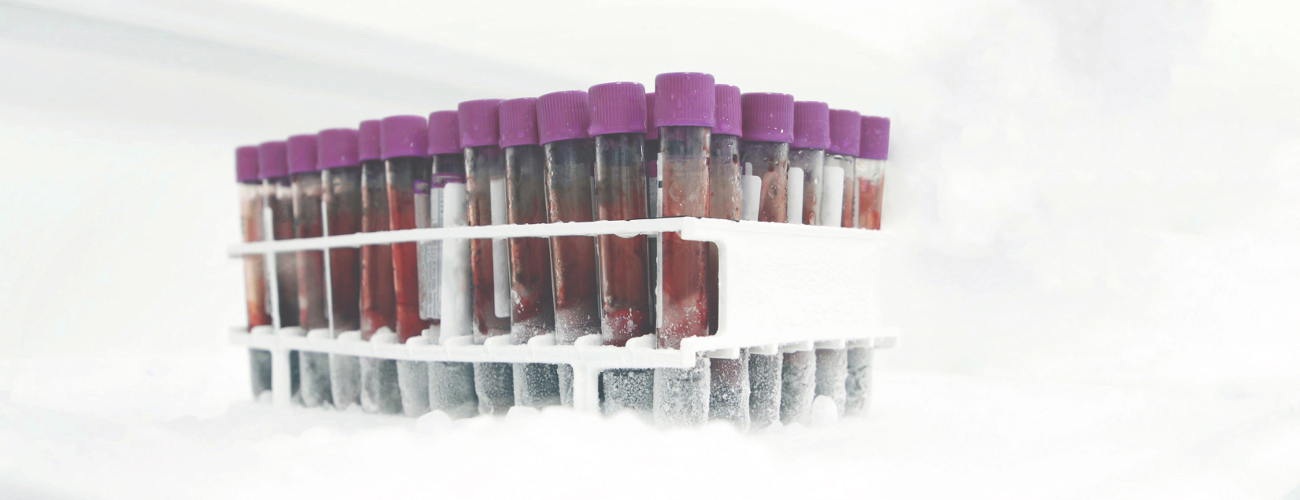


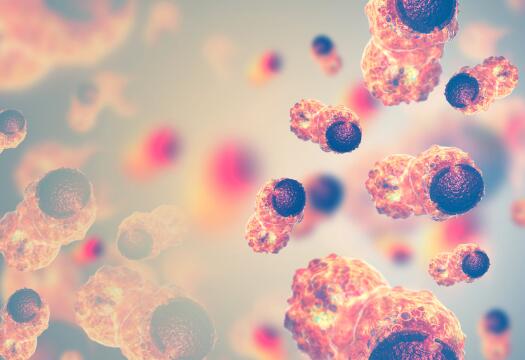



Kommentare