
Wie kommuniziert man Wissenschaft in Zeiten der Pandemie? Beatrice Lugger leitet das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik). Ein Gespräch über die unterschiedlichen Funktionsweisen von Wissenschaft und Medien, Filterblasen, und verständliche Sprache.
Foto: NaWik
Frau Lugger, wie stark hat die Covid-Pandemie unseren Blick auf Wissenschaft verändert?
Das hat sie extrem. Wir hatten vor Covid mehrheitlich eine Berichterstattung, die ergebnisorientiert war, also: ‚Das ist unsere Fragestellung, und die Wissenschaft kümmert sich darum.‘ Da gab es nur Erfolge und Entdeckungen. Die ganzen Jahre über hatte ich mir gewünscht, dass von der Wissenschaft mehr Prozesshaftes kommuniziert wird, dass Wissenschaft eben keine Einbahnstraße ist, sondern ein multifunktionales Herantasten von unterschiedlichen Playern, die international kooperieren – dass Vor- und Rückschritte dazugehören, auch sich widersprechende Erkenntnisse.
Das wurde vorher nie so kommuniziert…
…und jetzt in der Pandemie schon, der Lernprozess rund um das Virus liegt ja offen zutage. Dies hat aber zu Verwirrung bei einigen Teilen der Bevölkerung geführt. Man war nicht gewohnt, dass Wissenschaft nicht so toll funktioniert und rasch Lösungen präsentiert. Es überraschte viele, dass die Wissenschaft sich nicht so einig ist und eigene Ergebnisse hinterfragt.
Dabei hat die Wissenschaft sogar geliefert und Lösungen präsentiert, zum Beispiel Impfstoffe.
Ja, die sind aber unterschiedlich validiert und haben unterschiedliche Funktionsweisen – allein das überrascht viele, weil sie den einzigen Impfstoff wie bei der Grippe gewohnt war.
Könnte es auch daran liegen, dass die Welt gerade sowieso komplizierter wird und der Mensch sich nach einfachen Antworten sehnt?
Diesen Prozess haben wir schon lange vor Corona gehabt. In der Wissenschaftskommunikation haben wir uns bereits von dem so genannten Defizit-Modell verabschiedet. Dieses sagte: Wir müssen die Bürger nur mit Wissen ausstatten, und dann werden sie schon die richtigen Entscheidungen treffen. Wir können aber dieses Wissen nicht auffüllen. Es ist zu groß und nicht vollumfänglich vermittelbar.
Beschränktes Zugangswissen ist das eine, aber wie erklären Sie sich das Paradox – einerseits die nachweisbaren, offensichtlichen Erfolge der Wissenschaft – andererseits der aufstrebende Denialism – quasi die Abkehr vom Glauben an die Wissenschaft?
Als aufstrebend würde ich ihn nicht bezeichnen. Wir nehmen ihn nur deutlicher wahr. Die Sozialen Medien liefern dafür eben einen größeren Resonanzboden! Außerdem beflügelt jede Krise jene, die einen grundsätzlichen Hang zum Verschwörungstheoretischen pflegen. Ähnlich geschah es mit der „Flüchtlingskrise“ von 2015, da entstanden auch die wildesten Geschichten. Und in den Medien werden diese so genannten „Skeptiker“ hofiert. Über eine kleine Demo von 300 Menschen gegen den Lockdown etwa wurde berichtet, als habe es sich um eine Großveranstaltung gehandelt.
Was ist dagegen zu tun – und was kann Wissenschaftskommunikation dagegen tun?
Zum Beispiel auch in die Sozialen Medien gehen. Ich bin davon überzeugt, dass große Teile der Wissenschaft und viele große Medienhäuser das viel zu lange versäumt haben. Der Aufbau einer Community geschieht nicht über Nacht. Wissenschaft braucht ein stärkeres Gesicht in Sozialen Medien. So können Wissenschaftlerinnen auch transportieren, dass sich hinter ihrer Forschung nichts Geheimnisvolles oder Abgeschlossenes verbirgt, sondern dass sie sehr menschlich ist.
Kommt das gegen Corona-„Skeptiker“ oder „-leugner“ an?
Wir werden sehr wahrscheinlich diese Filterblasen nicht erreichen. Dort hat man sich zu sehr eingenistet: Eine Bekehrung, dass die Welt doch rund ist, halte ich bei manchen für utopisch. Solche Grundhaltungen ändern sich vielleicht nur durch starke Einschnitte im persönlichen Leben. Es gibt Grenzen der Kommunikation, aber nichtsdestotrotz sollte die Flagge gehisst werden – vor allem für die große graue Masse der Unentschiedenen. Nehmen Sie das Wissenschaftsbarometer der Initiative „Wissenschaft im Dialog“: Da sind 30 bis 40 Prozent der Befragten, die der Wissenschaft nicht misstrauen, ihr aber auch nicht vertrauen; das ist eine ganz wichtige Gruppe. Wenn uns die abdriftet, haben wir echt ein Problem.
Hat denn Wissenschaft bei der Kommunikation während der Pandemie Fehler gemacht?
Natürlich wurden Fehler gemacht. Denken Sie nur an eine so genannte „Studie“ eines Physikers an der Uni Hamburg, die einfach nur eine schwache und interessengetriebene Sammlung war – eben die „These“, das Coronavirus sei ursprünglich einem Labor entwichen. Dennoch gab die Presseabteilung der Universität diesem zuerst Rückendeckung. Das war sehr misslich. Für die Medien gibt es den Presserat, der falsches Verhalten rügt. Solch ein Regularium wünsche ich mir auch für die Wissenschaftskommunikation.
Und was noch?
Anfangs wandte man sich nur an die Virologen und an die Epidemiologen. Es gehören aber auch andere Fachbereiche mit ins Boot: von den Soziologen, Bildungswissenschaftlern hin zu Politologen. Da wurde mittlerweile hinzugelernt. Bei der Leopoldina zum Beispiel, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, sind jetzt bei einem Papier all diese Fachrichtungen dabei. Auch auf eine gendergerechte Besetzung wird mehr Augenmerk gerichtet. Vielleicht hat die Krise hier Positives bewirkt: Nun haben wir eine schnelle Kommunikationstruppe der Wissenschaft als ein Grundgerüst für künftige Krisen.
Wurden eigentlich der Wissenschaft Aufgaben aufgebürdet, die eigentlich nicht ihre sind?
Kommunikation muss man lernen. Wissenschaftlerinnen sollten reflektieren: In welcher Rolle bin ich, bis wann kann ich als Expertin auftreten und ab wann muss ich sagen, dass meine Äußerung eine Meinung ist, die nicht wertvoller ist als die meines Nachbarn? Als Christian Drosten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der Bundespressekonferenz erschien und Hendrik Streeck mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet – da hatte konnte man schon den Eindruck gewinnen, dass da jemand vor einen Karren gespannt wird.
Auf der anderen Seite ist der Austausch unterschiedlicher Argumente ein wissenschaftliches Vorgehen an sich. Wie lassen sich inhaltliche Differenzen unter Wissenschaftlern schildern, ohne dass der öffentliche Eindruck von Kakophonie aufkommt?
Die Wissenschaftler untereinander tun das. Die haben ihre Kongresse, tauschen sich aus und halten den wissenschaftlichen Disput. Wir haben hier aber nun eine Mediendynamik. Medien greifen nach Streit und Zerrissenheit, das „Pro“ und „Kontra“ sind verlockende und leicht verständliche Profile, das wird bewusst getriggert. Und entsprechend sind dann zum Beispiel Fernseh-Talkshows mit Leuten besetzt, um die Aufmerksamkeitsökonomie zu bedienen.
Können sich Wissenschaftler dieser Ökonomie entziehen?
Sie sollen ruhig in Talkshows gehen, aber sich ihrer Rolle dort bewusst sein. Und sich bei einer Anfrage vorab mal die Namen der anderen Eingeladenen geben lassen – wenn klar wird, dass die Redaktion auf bloßen Krawall aus ist, kann auch mal absagen. Man muss sich nicht an jeder Diskussion beteiligen.
Sie hatten anfangs von dem zu großen Wissen gesprochen. Und nun sind wir bei den Medien, die gern einfache Fronten haben. Wie komplex darf die Kommunikation von Wissenschaft denn sein?
Man kann komplexe Sachverhalte herunterrechnen, und zwar bis zu einer Schmerzgrenze, bei welcher der Wissenschaftler sagt: Das ist korrekt, auch wenn ich es stark vereinfacht habe. Wissenschaftler haben schon die Aufgabe, so zu sprechen, dass ein Inhalt nicht missinterpretiert werden kann. Sie sollten Journalisten nicht zu Übersetzern machen. Das tun sie am besten selbst, dann verlieren sie auch nicht die Deutungshoheit.
Trifft das auf alle Sachverhalte zu?
Es gibt von Albert Einstein den schönen Spruch: ‚Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es nicht verstanden.‘ Ich lass das mal so stehen.
Im Zweifel wird es nicht die letzte Pandemie gewesen sein – was ist für die Zukunft zu tun?
Wissenschaftskommunikation sollte stärkerer Bestandteil der wissenschaftlichen Ausbildung werden – also mit Angeboten in jeder Stufe. Wir reden ja häufig von Medienkompetenz, die schon in den Schulen gelehrt werden sollte. Zumindest für Studierende sollte so etwas gesetzt sein, um sie später als Forscher nicht in die Falle der Mediendynamiken tappen zu lassen.
Kommunikation wird bedeutsamer werden?
Das ist sie bereits. Aber derzeit wird noch vieles inszeniert auf die Beine gestellt, ohne dass über die Qualität reflektiert wird. Wir brauchen aber in der Wissenschaftskommunikation mehr Qualitätssicherung.
Foto: Shutterstock

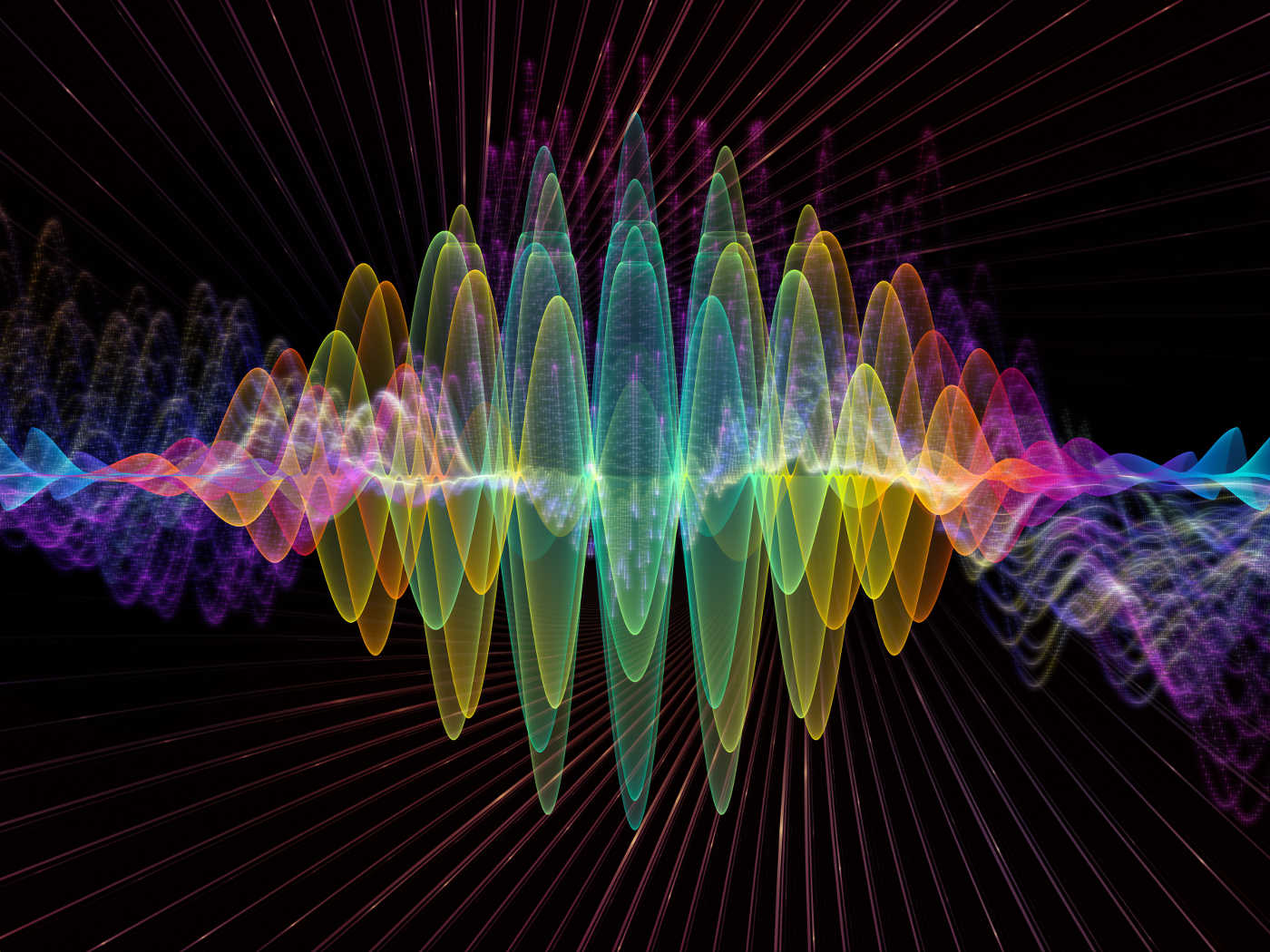



Kommentare